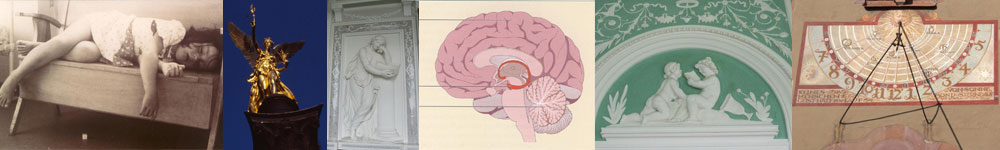Neu ist es nicht, dass Schlaf als Zeitverschwendung betrachtet wird, als überflüssig oder einfach lasziv. Seit Jahrhunderten versprechen sich Menschen, religiös oder spirituell weiterzukommen, wenn sie weniger schlafen. Seit jedoch Calvin und andere Protestanten der strengeren Provenienz in Mittel- und Nordeuropa an Einfluss gewannen, begann man, den Schlaf generell zu verachten. Max Weber weist darauf hin. In seiner 1912 erschienenen Studie „Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus“ arbeitet er heraus, dass dieser Ethik gemäß ein gottgefälliges Leben mit Arbeit gefüllt ist, was sich im finanziellen Erfolg widerspiegelt. Mit dabei: wenig Schlaf. Max Weber zitiert Richard Baxter, einen Puritaner aus dem 17. Jahrhundert, der schreibt: „Zeitverlust durch Geselligkeit, »faules Gerede«, Luxus, selbst durch mehr als der Gesundheit nötigen Schlaf – 6 bis höchstens 8 Stunden – ist sittlich absolut verwerflich.“
Mit der „Sittlichkeit“ haben wir es heute nicht mehr so. Und dennoch gilt viel Schlaf als unmoralisch, ja bereits Baxters „sechs bis acht Stunden“ sprechen vielen schon für zweifelhafte Leistungsbereitschaft. Sie bewundern Leute, die wenig schlafen, gerne auch selbst – einige Einträge in diesem Blog befassen sich bereits damit.
Olaf Tscharnezki hat diese Negativhaltung wunderbar auf den Begriff gebracht: „Kriminalisierung des Schlafs“. Tscharnezki ist kein Spinner und kein Mitglied der Müßiggänger-Fraktion. Er ist Betriebsarzt, und zwar bei Unilever. Dort betreibt er, wie er in einem Interview für die „Initiative neue Qualität der Arbeit“ erklärt, die „Entkriminalisierung von Schlaf“. Konkret: Er hat in der Hamburger Zentrale eine „Ruheoase“ eingerichtet. Dort „dürfen“ sich Mitarbeiter erholen und sogar ein kleines Tagschläfchen halten, ohne gleich schief angeschaut zu werden. Tscharnezki konnte das durchsetzen, weil die Leute vor wenigen Jahren massiv vom Stress geplagt waren – 60 Prozent, fast zwei von drei Mitarbeitenden, klagten damals über schlechten Schlaf.
Nun können Schlafstörungen vielerlei Gründe haben. Doch sehr oft haben sie tatsächlich mit Stress am Arbeitsplatz zu tun. Der steigt, wenn die Leute über den Tag von ihrem Anspannungspegel nicht herunterkommen, und er steigt noch mehr, wenn sie abends an ihren Schreibtischen festkleben. Wer so arbeitet, kann abends nur schwer abschalten. Doch ausgerechnet Abschalten ist unerlässlich, um gut zu schlafen. Schlafen heißt, dass der Kopf „herunterfährt“. Das tut er nicht auf Befehl und schon gar nicht schnell. Dafür braucht er Zeit, und, wenn man so will, Übung: das sind die Pausen während des Tages. Möglicherweise in der Ruheoase.