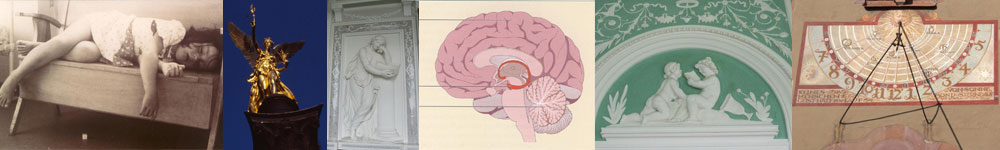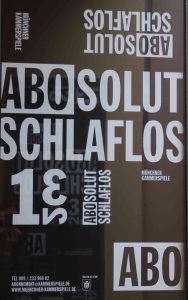Eine Rezension
Noch sind es keine Computerprogramme, die Menschen ermorden, sondern Menschen. Und Menschen werden müde, schlafen zu den unmöglichsten Zeiten ein, schlafen vor oder nach ihrer verbrecherischen Tat oft schlecht, und sind danach erst richtig müde, so müde. All das erscheint in dieser Kurzkrimi-Sammlung „Beichte und Bestechung“, wenn auch nur nebenbei. Zentral stellen fünfzehn Autorinnen ihre eigene Hauptfigur vor, samt ihrer kriminellen Taten.
Die Figuren lernen sich ausgerechnet in einem Nonnenkloster in Bayern kennen, das allerdings existenzgefährdend verarmt ist. So sucht die verantwortungsvolle Äbtissin überall nach neuen Geldquellen. Schließlich hat sie sich vor Jahrzehnten auf Gedeih und Verderb nicht nur dem Wohl ihres mystischen Bräutigams Jesus verschrieben, sondern auch dem seiner Klöster und der katholischen Kirche. Wenig zimperlich fischt sie Gelder ab, wo sie zu finden sind, bei Bigottischen, schrägen Vögeln und Hochkriminellen. Erbschaften, Schweigegelder und Seminargebühren, von allem etwas.
Die Selbsthilfegruppe der Äbtissin Fabiola
Zusammen mit dem örtlichen Pater Quirin ruft Äbtissin Fabiola eine Selbsthilfegruppe für Schwerkriminelle ins Leben. Geeignete Personen spricht Pater Quirin in seiner Online-Beichtgruppe an, die er im Darknet betreibt. Bald beginnen diese, sich regelmäßig analog und physisch im Kloster zu treffen und sich alles von der Seele zu reden, was sie kriminalistisch so bewegt. Männer und Frauen nehmen teil, Ältere und Jüngere, Eiskalte und Liebende, in voller Absicht Mordende und unabsichtliche Arrangeure merkwürdiger Unfälle. Wie in jeder Psychogruppe schwören sie strengstes Stillschweigen, nicht nur über die Taten, sondern auch über die Gruppe als solche. Was Kriminelle ernster nehmen als andere. In der Unterwelt hängt sowieso die „Ehre“ am Schweigen, aber die Gruppenmitglieder profitieren auch unmittelbar davon, liefern sie doch in jeder Sitzung Geständnisse, die abzuhören für die Polizei eine Freude wäre. Einen Fehler jedoch macht der schöne und schlaue Pater Quirin, und er wird ihn sich nie verzeihen: Die Undercover-Journalistin erkennt er erstmal nicht.
Die Geschichten sind frech und schlau, die Plots stimmig und rund, aufgeschrieben haben sie Profis. Das liest sich sowieso flüssig, vieles ist zum Tot(sic!)lachen. Tatsächlich stirbt kein Opfer, weil es sich totlacht, sondern alle durch makabre Unfälle, abstruse Zufälle, Gift im Essen oder in Blumen, allergische Schocks oder durch allerlei andere ungewöhnliche Ereignisse. Niemand ermittelt, man kriegt alles mit, und es sieht so aus, als laufe das fröhliche Morden immer weiter. Und im Gegensatz zu einigen Teilnehmenden schläft die Äbtissin völlig ruhig.